Das AB0-System und der Rhesusfaktor.
Die Übertragung von Spenderblut ist in der modernen Medizin ärztliche Routine. Sie rettet das Leben von schwerstverletzten Unfallopfern und Frauen mit Geburtskomplikationen. Sie dient der Behandlung von Menschen mit Blutarmut oder wird bei Eisenmangelzuständen, die sich nicht anders beheben lassen, durchgeführt. Sie ermöglicht zudem komplizierte Operationen.
Die Übertragung von Blut – der Fachbegriff lautet Transfusion – war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts kaum möglich. Versuchten Ärzte es dennoch, starben die Menschen oft an Unverträglichkeiten. In unserem Magazinbeitrag erklären wir euch, warum Transfusionen damals so gefährlich waren und heute problemlos möglich sind. Ihr erfahrt, wer das Blutgruppensystem entdeckt hat und welche Unterschiede es zwischen den Blutgruppen gibt.
- Die Entdeckung der Blutgruppen – Meilenstein der Medizin.
- Wie unterscheiden sich Blutgruppen voneinander?
- Verträglichkeit – wer kann wem Blut spenden?
- Warum ist Blutspenden so wichtig und wie läuft die Spende ab?
Die Entdeckung der Blutgruppen – Meilenstein der Medizin.
Bevor die Blutgruppen bekannt waren, bedeutete ein starker Blutverlust in der Regel den Tod. Da es nicht möglich war, den Verlust auszugleichen, starben die Betroffenen an Blutmangel. Zwar gab es bereits im 19. Jahrhundert Versuche mit Transfusionen. Die Patienten starben dennoch häufig. Blut war offenbar nicht gleich Blut.
Der Wiener Arzt Karl Landsteiner wollte dem Geheimnis auf die Spur kommen. Im Jahr 1900 machte er eine wichtige Entdeckung. Er entnahm sich selbst und einigen Mitarbeitern Blutproben. Als er die Proben mischte, stellte er fest, dass manche davon klumpig wurden. Die Blutproben hatten unterschiedliche Eigenschaften, die nicht zueinander passen. Landsteiner schloss daraus, dass es verschiedene Blutgruppen geben müsse und veröffentlichte diese These 1901 in einer wissenschaftlichen Arbeit. Er nannte die entdeckten Varianten A, B und C. Aus der letzten wurde später die Gruppe 0. Im Jahr 1902 entdeckten seine Assistenten dann eine vierte Blutgruppe: AB. Im Jahr 1928 einigte man sich international darauf, das AB0-System zur Unterscheidung von Blutgruppen zu verwenden.
Karl Landsteiner erhielt 1930 für seine Leistungen den Nobelpreis der Medizin. Später entdeckte er mit einem weiteren Wissenschaftler auch noch den sogenannten Rhesusfaktor im Blut einer bestimmten Affenart, der Rhesusaffen.
Wie unterscheiden sich Blutgruppen voneinander?
Experten-Wissen:
„Das Geheimnis liegt in den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten. Sie sind von einer Hülle umgeben, die bestimmte Strukturen aufweisen. Diese nennt man Antigene“, erklärt Dr. Markus Bruckhaus-Walter, Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin. „Sie geben der jeweiligen Blutgruppe ihren Namen.“
- Blutgruppe A: Auf der Hülle der roten Blutkörperchen befindet sich nur das Antigen A.
- Blutgruppe B weist nur das Antigen B auf.
- In der Blutgruppe 0 sind weder A- noch B-Antigene vorhanden.
- Die Blutgruppe AB enthält beide Antigene.
Was heißt das nun für dich? Es bedeutet, dass dein Blut Antikörper gegen andere Blutgruppen bilden kann. Im Fall der Blutgruppe A gegen Antigen B. Bei der Blutgruppe B ist es umgekehrt. Die Blutgruppe 0 bildet Antikörper gegen die Antigene A und B. Die Blutgruppe AB bildet gar keine Antikörper.
Ein zweites wichtiges Unterscheidungsmerkmal bildet der Rhesusfaktor. Ist dieser auf der Hülle der roten Blutkörperchen vorhanden, spricht man von Rhesus-positiv (Rh-positiv). Fehlt das Merkmal, bist du Rhesus-negativ (Rh-negativ).
Die Blutgruppe ist vererbbar. Welche Merkmale du hast, wird also durch die Blutgruppen deiner Eltern festgelegt.
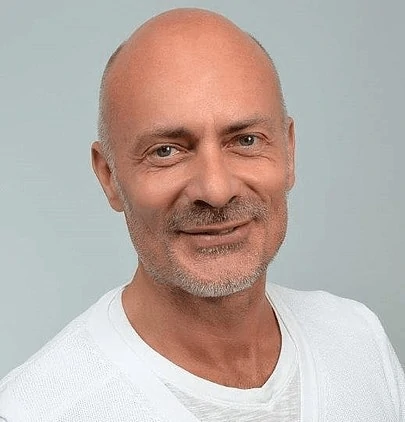
Tipp unseres Experten:
Welche Blutgruppe gibt es am meisten? „In Deutschland und Mitteleuropa sind Blutgruppe A und Blutgruppe 0 am häufigsten. Andere Blutgruppen sind deutlich seltener. Der Rhesusfaktor ist bei den meisten Menschen positiv“, so Dr. Bruckhaus-Walter.
Expertenprofil lesenIn Kombination mit dem Rhesusfaktor ergeben sich insgesamt 8 Blutgruppen-Varianten:
- Blutgruppe A positiv
- Blutgruppe A negativ
- Blutgruppe B positiv
- Blutgruppe B negativ
- Blutgruppe AB positiv
- Blutgruppe AB negativ
- Blutguppe 0 positiv
- Blutgruppe 0 negativ
Verträglichkeit – wer kann wem Blut spenden?
Das AB0-System ermöglicht Ärzten, die passende Blutspende für schwer kranke Patienten zu finden. Doch welche Blutgruppen sind kompatibel?

- Ein Mensch mit Blutgruppe A+ kann Blut an Menschen mit den Gruppen A+ und AB+ spenden. Er selbst verträgt Blut von Spendern mit den Blutgruppen 0+, 0-, A+ und A-.
- Hat jemand A-, kommt er als Spender für Empfänger mit den Gruppen A+, A-, AB+ und AB- in Frage. Als Empfänger kann er Blut von A- und 0-Spendern bekommen.
- B+: Der Träger kann sein Blut an Menschen mit AB+ und B+ spenden. Er verträgt die Blutgruppen B+, B-, 0+ und 0-.
- B-: Menschen mit diesem Merkmal können für Personen mit AB+, AB-, B+ und B- spenden. Sie können Spenden von B- und 0-Personen bekommen.
- Wer die Blutgruppe AB+ sein Eigen nennt, kann nur an Träger des gleichen Merkmals spenden. Dafür verträgt er aber alle anderen Blutgruppen.
- Bei AB- Blutspenden kommen nur Träger der Merkmale AB+ und AB- als Empfänger in Frage. Andere Menschen vertragen dieses Blut nicht. Wer die Gruppe AB- besitzt, darf auch nur Blutspenden von Rhesus-negativen Personen erhalten: AB-, A-, B- und 0-.
- Menschen mit der Gruppe 0+ können nur an Rhesus-positive Menschen spenden: AB+, A+, B+ und 0+. Sie selbst vertragen die Blutgruppen 0+ und 0-.
- Schließlich die Blutgruppe 0-. Menschen mit diesem Merkmal sind als Blutspender besonders begehrt. Das liegt daran, dass ihr Blut für Menschen mit allen anderen Blutgruppen verträglich ist. Deshalb nennt man sie auch Universalspender. Benötigen sie selbst allerdings eine Bluttransfusion, sieht es deutlich schlechter aus. Sie vertragen lediglich eine einzige Blutgruppe: Ihre eigene, also 0-.
Warum ist Blutspenden so wichtig und wie läuft die Spende ab?

Jede Blut- oder Plasmaspende ist wichtig. Blut kann nur durch Blut ersetzt werden. Obwohl die Medizin seit der Entdeckung Karl Landsteiners riesige Fortschritte gemacht hat, ist die Herstellung von künstlichem Blut bisher nicht gelungen. Um Menschen mit starkem Blutverlust zu retten, sind Ärzte daher weiterhin auf Blutbanken angewiesen.
Das Tolle ist, dass jeder Mensch ganz einfach zum Lebensretter werden kann.
Experten-Wissen:
„Wer erwachsen, gesund und fit ist sowie mehr als 50 Kilogramm wiegt, kann Spender werden“, erklärt der Experte. Vorausgesetzt natürlich, es gibt sonst keine medizinischen Gründe, die dagegensprechen.
Um das abzuklären, musst du zunächst einen Fragebogen ausfüllen. Darin wird zum Beispiel nach Medikamenten gefragt, die du nimmst oder nach Erkrankungen, die du kürzlich hattest. Vor dem Fragebogen musst du keine Angst haben. Er dient nur deiner Sicherheit und der Sicherheit des Empfängers.
Danach wird deine Körpertemperatur gemessen – um eine akute Infektion auszuschließen – und mit einer kleinen Blutprobe der sogenannte Hb-Wert bestimmt. Hb steht für Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff. Ist die Konzentration in deinem Blut zu niedrig, darfst du an diesem Tag nicht spenden. Auch das dient deinem Schutz und soll gesundheitliche Probleme nach der Spende vermeiden.
Schließlich bespricht ein Arzt mit dir deinen Fragebogen und misst Puls sowie Blutdruck. Ist alles Okay, kann es mit der Spende losgehen.
Während der Blutspende werden dir etwa 500 ml Blut entnommen. Das dauert in der Regel nicht länger als zehn Minuten. Im Anschluss darfst du dich noch etwas ausruhen und bekommst einen kleinen Imbiss und etwas zu Trinken. Das hilft deinem Körper, die Spende besser zu verarbeiten und beugt Kreislaufproblemen nach der Spende vor.
Blutspenden sind bei vielen Hilfsorganisationen und Blutspendediensten möglich. Im Netz findest du mit ein paar Klicks Anlaufstellen in deiner Region.
Eine regelmäßige Blutspende rettet Leben. Hier erklären wir dir, wie du dein eigenes Blutbild verstehen kannst. Darüber hinaus entscheiden sich immer mehr Menschen dazu, Organ- und Gewebespender zu werden. Auf unserer Website liest du mehr zur Organspende.






Sie schreiben folgenden Satz:
„Menschen mit der Gruppe 0+ können nur an Rhesus-positive Menschen spenden: AB+, A+, B+ und 0+. Sie selbst vertragen die Blutgruppen 0+ und 0-.“
Jedoch ist die Grafik falsch, da hier B- als Empfänger von 0+ angezeigt wird.
Bitte um Prüfung der Grafik!
Hallo Jens,
da hast du natürlich recht. Offenbar ist uns hier in der Grafik ein Fehler unterlaufen. Vielen Dank für den Hinweis, wir werden das überarbeiten.
Viele Grüße, Maja vom Social Media-Team der KNAPPSCHAFT
Hallo, habe vor mehr wie 19 Jahren selber mehrere Bluttransfusionen erhalten. Wollte vor paar Jahren selbst spenden, dies wurde mir jedoch verwert. Warum?
Hallo Natalia,
warum du damals nicht spenden durftest, können wir leider nicht einschätzen. Dass man selber schon einmal Bluttransfusionen erhalten hat, ist grundsätzlich kein Ausschlussgrund.
Allerdings gibt es eine Ausnahme. Diese betrifft Menschen, die sich zwischen 1980 und 1996 mehr als sechs Monate in Großbritannien oder Nordirland aufgehalten oder nach dem 1. Januar 1980 dort eine Blut- oder Plasmaspende erhalten haben. Da bei diesem Personenkreis eine Infektion mit TSE-Erregern (diese lösen unter anderem die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit aus) nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen diese Personen nicht spenden. So besagt es die Richtlinie zur Blutspende der Bundesärztekammer.
Auch andere chronische oder akute Erkrankungen können zu einem dauerhaften oder zeitweiligen Ausschluss führen.
Am besten ist es in solchen Fällen immer, direkt nachzufragen. Die Mitarbeiter der Blutspendedienste erklären dir dann, warum du nicht zur Spende zugelassen wirst.
Viele Grüße
Maja vom Social Media-Team der KNAPPSCHAFT
Guten Tag! Kann man in der Sulzbacher Klinik Blut spenden? Ich lese immer öfter das e dringend benötigt wird! Oder wo kann man spenden?
Danke für die Antwort
Hallo Michaela,
auf der Seite der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes kannst du über die Eingabe eines Ortes und eines Umkreises in km nach Terminen für Blutspenden in deiner Region suchen. Da sind sicher auch Termine für Sulzbach dabei.
https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/
Ansonsten kannst du natürlich auch direkt beim Krankenhaus nachfragen, ob es dort Möglichkeiten der Spende gibt.
Viele Grüße
Maja vom Social Media-Team der KNAPPSCHAFT
Hallo
Warum dürfen Menschen mit MS Multiple Sklerose kein Blut spenden? Ist doch nicht ansteckend
Hallo,
dass Menschen mit einer Multiplen Sklerose vom Blutspenden ausgeschlossen werden, hat nichts mit einer etwaigen Ansteckungsgefahr zu tun. Wie du richtig sagst, handelt es sich bei MS nicht um eine Infektionskrankheit. Allerdings müssen MS-Patienten verschiedene Medikamente zur Behandlung ihrer Erkrankung nehmen, die möglicherweise ein Risiko für die Empfänger (z.B. Schwangere, Kinder) einer Blutspende darstellen könnten. Zumindest lässt sich das nicht komplett ausschließen. Daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Auf keinen Fall sollen Menschen mit MS dadurch diskriminiert werden.
Viele Grüße
Maja vom Social Media-Team der KNAPPSCHAFT
So dringend kann Blut garnicht gebraucht werden. Homosexuellen Menschen wird immer noch abgesprochen Blut spenden zu können. Ich bin seit 7 Jahren mit meinem Mann verheiratet, wir leben treu und monogam…aber mein Blut ist nicht gut genug für die Gesellschaft. Ergo kann es nicht so schlimm sein.
Hallo, wie sieht es aus mit dem Spenden von Menschen, die Covid- insbesondere mRNA-Impfungen erhalten haben? Der empfangende Körper wird dies nicht immer vertragen oder möchte frei davon bleiben… Bitte um Information. Sehr gerne per Sie statt du. Danke!
Hallo Frau Schlecker,
vielen Dank für Ihre Nachfrage. Eine Blutspende nach einer Covid-Impfung ist laut Paul-Ehrlich-Institut für den Empfänger der Spende unproblematisch. Wer sich gegen Corona impfen lässt, sollte mit der Blutspende allerdings einen Tag warten.
Viele Grüße
Johanna aus dem Social Media-Team der KNAPPSCHAFT
Viele Jahre habe ich selber Blut gespendet, als Ergebnis von mehreren Blutübertragungen, Schluss war mit meinem 69. Lebensjahr. Wenn Blut so dringend benötigt wird, warum darf man im späteren Jahren Blut nicht mehr spenden? Ich bin Universalspender (0 negativ), habe gute Blutwerte und würde mit meiner Blutspende noch sehr gerne Menschen helfen, warum verweigert mir das?
Hallo Edelgard,
ein Ausschluss von der Blutspende erfolgt aufgrund medizinischer Kriterien und dient sowohl dem Schutz des Spenders als auch des Empfängers. Auch eine Altersgrenze dient dem Schutz des Blutspenders. Sicher gibt es in höherem Lebensalter viele Menschen, die bei guter Gesundheit sind und gerne weiter spenden möchten. Und die sich wie du darüber ärgern, wenn sie es nicht mehr dürfen. Das ist nachvollziehbar. Gleichwohl sollte man aber auch Verständnis für die Ärztinnen und Ärzte haben, die letzten Endes die Verantwortung für die Menschen tragen, die zur Blutspende kommen.
Viele Grüße
Finn vom Social Media-Team der KNAPPSCHAFT